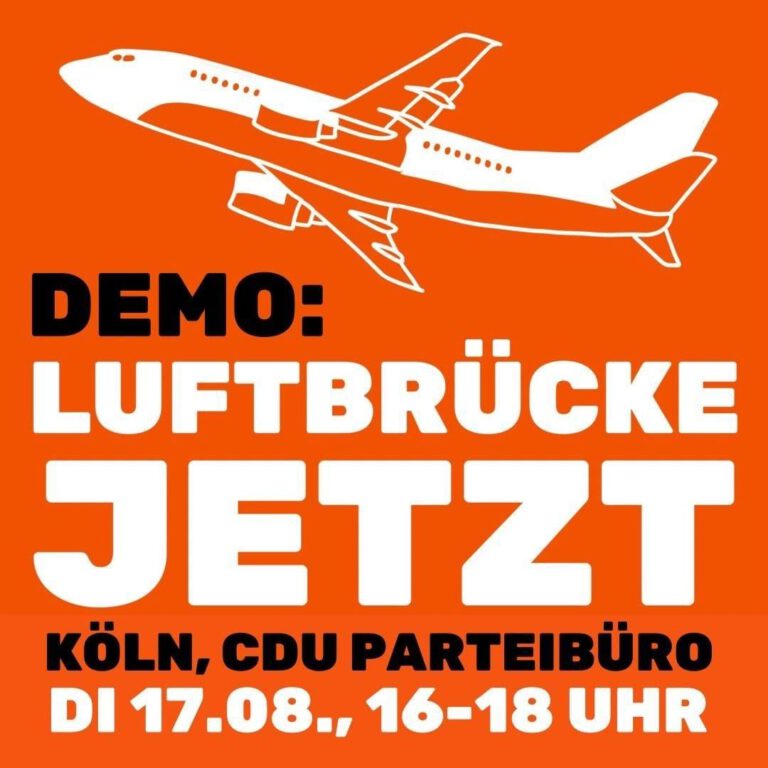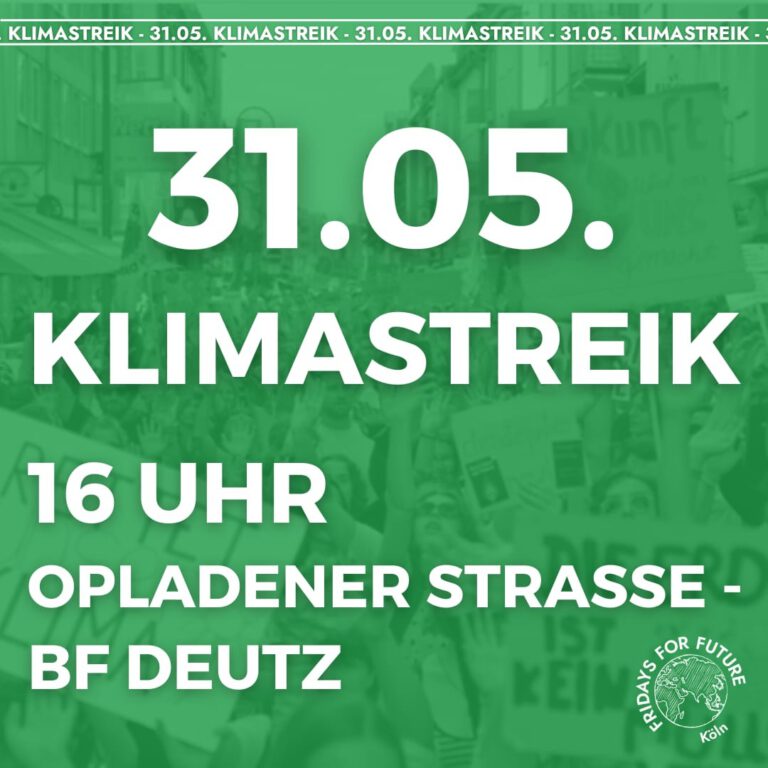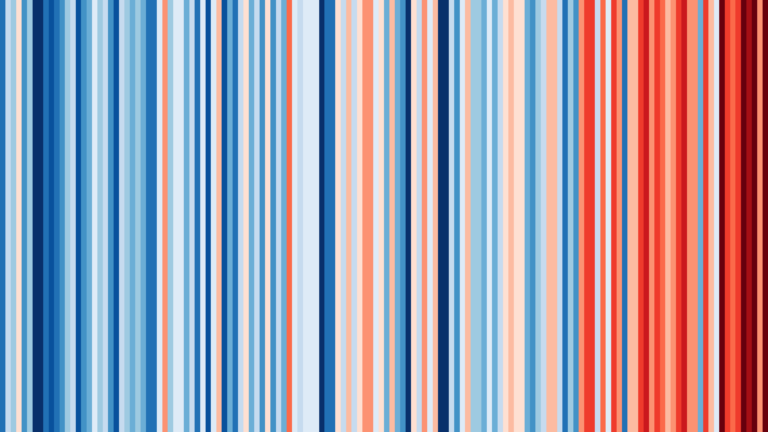Träum weiter… (IV): Wir Egoisten

Egoismus gilt innerhalb der Diskussion um Klimagerechtigkeit als verwerflich, ja als eine (charakterliche) Ursache der ganzen Misere, sei es in Form von Profitgier oder Rücksichtslosigkeit bzw. Ignoranz der Allgemeinheit gegenüber. Die Frage seit Jahrhunderten lautet: wie bekommt man es hin, dass jeder Rücksicht auf die Interessen der Gemeinschaft nimmt?
Der Mensch ist zugleich egoistisch und kooperativ
Der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. Einerseits egoistisch, andererseits auf Kooperation angewiesen. Religion als auch Philosophie versuchen diesen Widerspruch aufzulösen. Z.B. durch die zehn Gebote kombiniert mit der Vorstellung eines allmächtigen und gerechten Gottes (Religion) oder durch Theorien über Moral und der Berufung auf die Vernunft (Philosophie).
Moralische Appelle?
Jetzt könnte man die Lösung in der Forderung sehen, dass wir uns alle wie kooperative Egoisten verhalten sollten. Aber gesellschaftliche Konflikte durch Moral bzw. durch moralische Appelle zu lösen hat noch nie nachhaltig funktioniert bzw. auf der zwischenmenschlichen Ebene nur neue Konflikte erzeugt.
Wir sind Gefangene
Ein wichtiger Faktor für Kooperation ist Erwartungssicherheit. Das macht das Gedankenexperiment des Gefangenendilemmas deutlich. Man kann damit klar machen, warum Menschen egoistisch handeln, obwohl Kooperation für jeden besser wäre.
Es lautet so: zwei mutmaßliche Verbrecher, die gemeinsam eine Tat begangen haben, werden unabhängig voneinander verhört. Sie haben während dieser Zeit keinerlei Kontakt zueinander. Die Polizei hat zwar Indizien für die Schuld der beiden, kann ihnen aber nichts Handfestes nachweisen. Sie macht jedem von beiden ein Angebot: „Wenn du gestehst, bekommst du 3 Jahre. Wenn du schweigst und der andere allerdings gesteht, 5 Jahre.“
Man sieht schnell, für beide wäre es das Beste, zu schweigen. Dann müssten sie laufen gelassen werden, da keine richtigen Beweise für ihre Schuld vorliegen. Aber da der eine nicht weiß, welche Möglichkeit der jeweils andere wählt, ist es aus der Sicht des jeweils Einzelnen die beste Wahl, wenn er gesteht. Schweigt man und der andere gesteht, bekommt man wie gesagt 5 statt 3 Jahre. Beiden Verbrechern fehlt Erwartungssicherheit, d.h. keiner kann sich darauf verlassen, dass der andere schweigt, obwohl es das Beste für beide wäre.
Das Gefangenen-Dilemma zeigt, warum umweltbewusstes Verhalten sich manchmal nur schwer durchsetzt. Obwohl alle wissen, dass es für jeden besser wäre, sich umweltbewusst zu verhalten, macht es die Mehrheit nicht. Solange ich mich nicht darauf verlassen kann, dass alle es tun, muss ich befürchten, dass ich allein die Kosten und Mühen auf mich nehme, es aber letztlich keinen Effekt hat.
Regeln statt Moralappelle
Nicht moralische Appelle, sondern (faire und nachvollziehbare) politische Regelungen schaffen Erwartungssicherheit in Bezug auf die Anderen und vermindern Konflikte. Moralische Appelle sind eher ein Ausdruck dafür, dass wir uns in einem Gefangenen-Dilemma befinden. Statt moralischer Appelle, klimaneutral zu produzieren oder zu konsumieren, muss es Regelungen geben, die dem Egoismus, d.h. der Freiheit legitime Grenzen setzen. Mit diesen Regeln müssen durchsetzbare Sanktionen (negativ oder positiv) verbunden sein. Jeder muss für sein Verhalten zur Verantwortung gezogen werden können. Da die Regeln für alle gelten, gibt es Erwartungssicherheit. Auch dann, wenn die Regeln in einzelnen Fällen nicht befolgt werden, wenn diese denn erfolgreich sanktioniert werden. Gibt es jedoch zu viele Regelbrüche oder unzureichende Sanktionen, ist dies ein möglicher Hinweis darauf, dass die Regel nicht funktional ist. Dann befinden wir uns wieder im Gefangenen-Dilemma.
Beitragsbild von fanette@pixabay
U-P4F-K